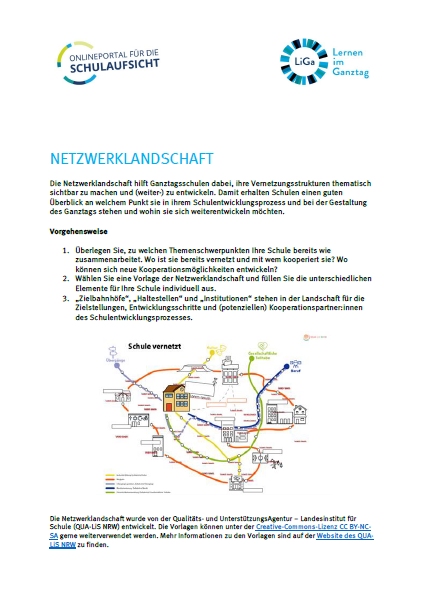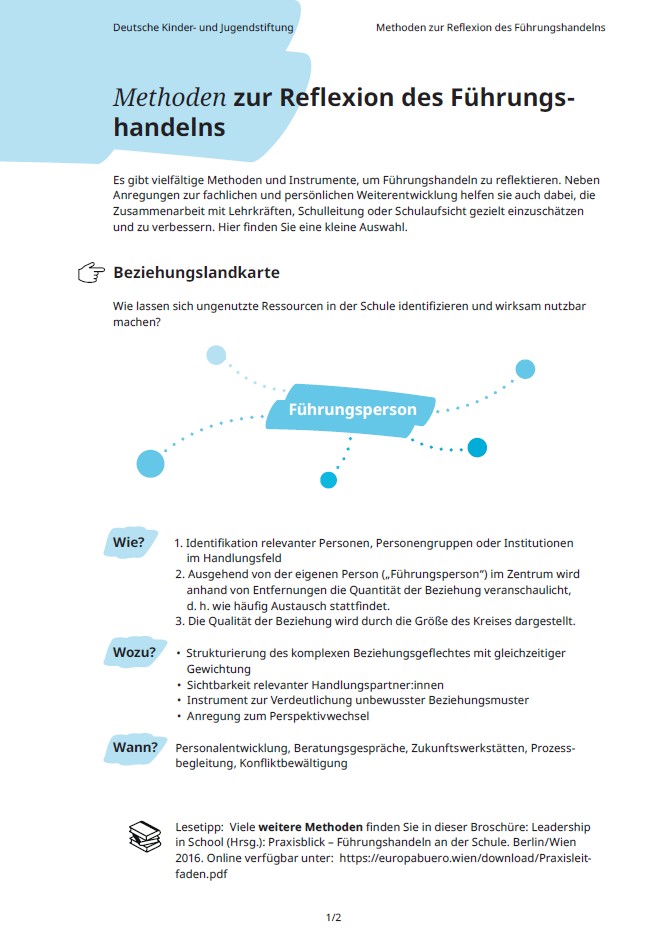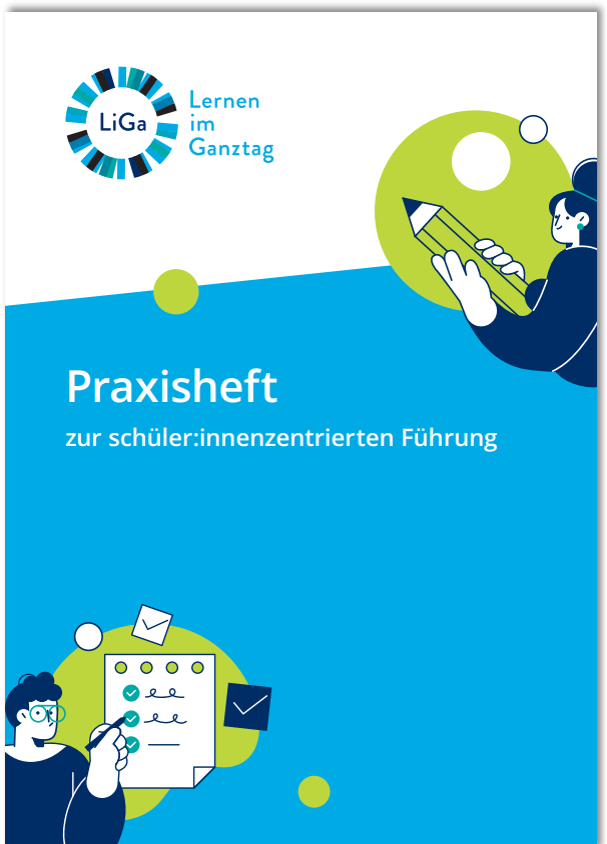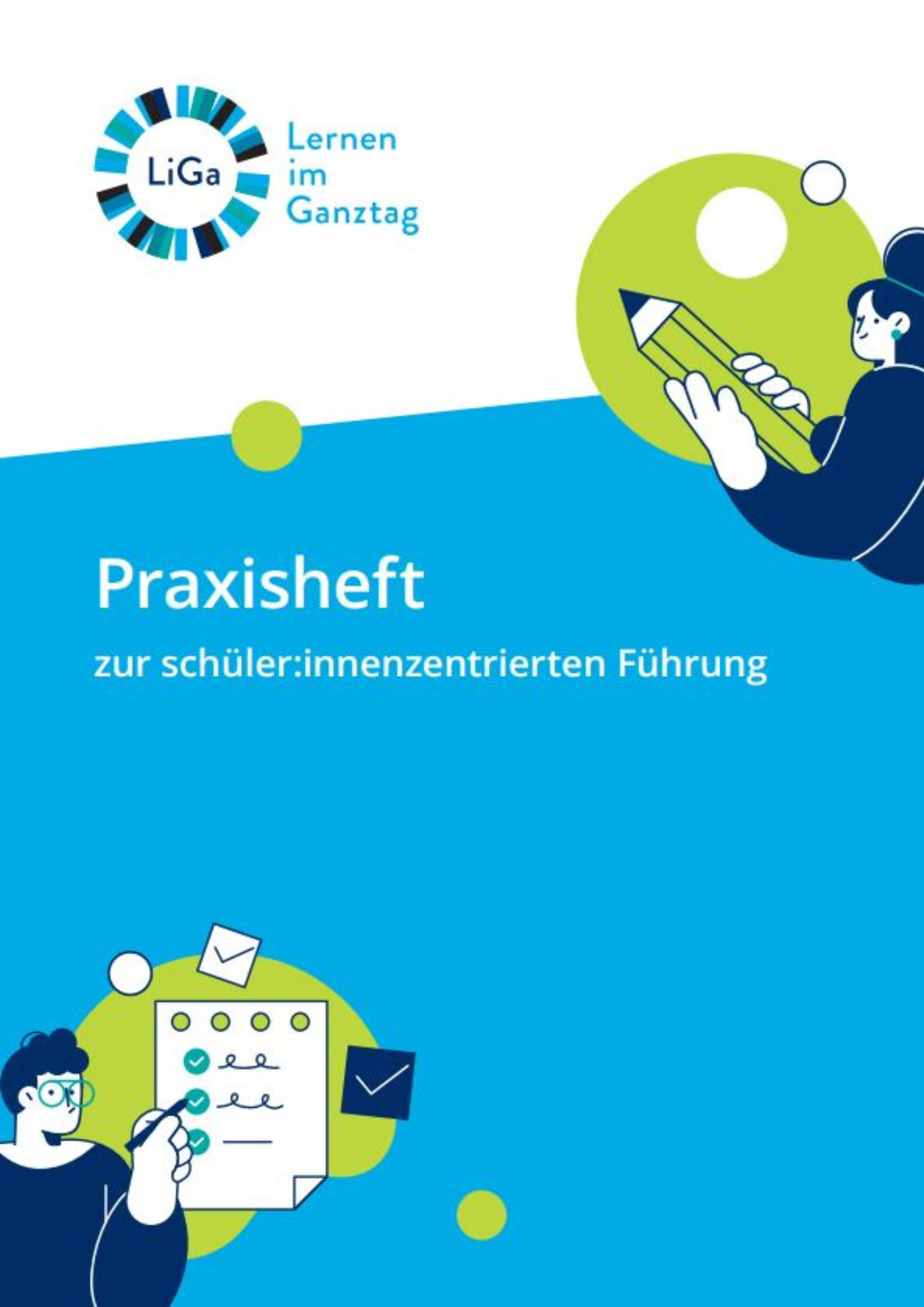Perspektiverweiterung mit Zirkulärem Fragen
Das Zirkuläre Befragen ist ein wesentlicher Bestandteil der systemisch-lösungsorientierten Beratung. Wie hilfreich diese Fragetechnik für Mitarbeitende der Schulaufsicht beim Thema Konfliktbearbeitung und -moderation sein kann, zeigte sich auch bei der sechsten Akademie für die Schulaufsicht im Rahmen des Programms „LiGa – Lernen im Ganztag“ am 22. März 2018 in Kiel. Die Kenntnis dieser Methode ist jedoch auch für Schulleiterinnen und Schulleiter gewinnbringend, beispielsweise in Gesprächen mit dem Kollegium.
Die Methode hat ihren Ursprung in der systemtherapeutischen Praxis. Sie dient dazu,
Prozesse in Beziehungssystemen zu veranschaulichen. Gewohnte Kommunikations- und Interaktionsmuster, die Konflikte innerhalb des Systems verursachen, können durch eine gezielte Einnahme von unterschiedlichen Beobachterpositionen und Perspektivwechseln reflektiert und neu bewertet werden. Problemerhaltende oder problemfördernde Zusammenhänge können mithilfe der zirkulären Frageweise aufgedeckt werden, indem die Beteiligten angeregt werden, ihre Vermutungen über die Sichtweisen anderer Systembeteiligter zu äußern. Dadurch entstehen neue Denkprozesse und es ergeben sich neue Handlungsoptionen hinsichtlich der Lösung von Herausforderungen.
Fragetechniken und Frageformen des Zirkulären Fragens
Fragen nach Unterschieden
- Klassifikationsfragen
- Unterschiede in Sichtweise und Beziehung werden in der Bildung von Rangfolgen greifbar.
- Beispiel: „Wer profitiert am meisten von der Situation?“
- Prozentfragen
- Anhand von Skalierungen werden Situationen quantitativ differenziert und präzisiert.
- Beispiel: „Wie hoch schätzen Sie auf einer Skala von 1 bis 10 die Zufriedenheit Ihres erweiterten Schulleitungsteams ein?“
- Übereinstimmungsfragen
- Diese Fragen geben Hinweise auf Beziehungskonstellationen.
- Beispiel: „Welcher Sichtweise würde die Kollegin X eher zustimmen?“
- Subsystemvergleiche
- Es werden empfundene Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Bedingungen verschiedener Interessensgemeinschaften im System verdeutlicht.
- Beispiel: „Wie ist die Beziehung zwischen dem sozialpädagogischen Personal und den Lehrkräften?“
Fragen nach Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktionen
- Problemorientierte Fragen (Verschlimmerungsfragen)
- Provozierende Fragen zeigen ein Worst-Case-Szenario auf. Indem sie zeigen, was sich ohne aktives Zutun negativ verändern könnte und welchen Nutzen das Problem möglicherweise hat, wird die aktuelle Situation umfassender eingeschätzt und kann das eigene Potenzial aufzeigen, aktiv zur Bewältigung beizutragen.
- Beispiel: „Was müssten Sie tun, damit die Schulentwicklung an Ihrer Schule völlig stagniert?“
- Lösungsorientierte Fragen (Verbesserungsfragen)
- Fragen nach Ausnahmen von Problemen
- Beispiel: „Wann haben Sie das Problem nicht? Was haben Sie und andere dann anders gemacht?“
- Fragen nach Ressourcen
- Beispiel: „Was soll aktuell so bleiben? Was ist gut daran?“ oder „Wie ist es Ihnen gelungen, schon so viel zu erreichen?“
- Wunderfragen
- Beispiel: „Angenommen, das Entwicklungsvorhaben wurde über Nacht an Ihrer Schule umgesetzt. Woran würden Sie das nun merken?“
- Fragen nach Ausnahmen von Problemen