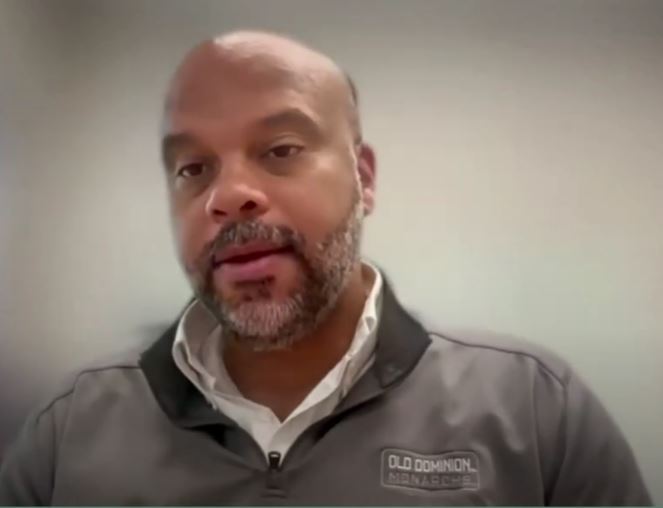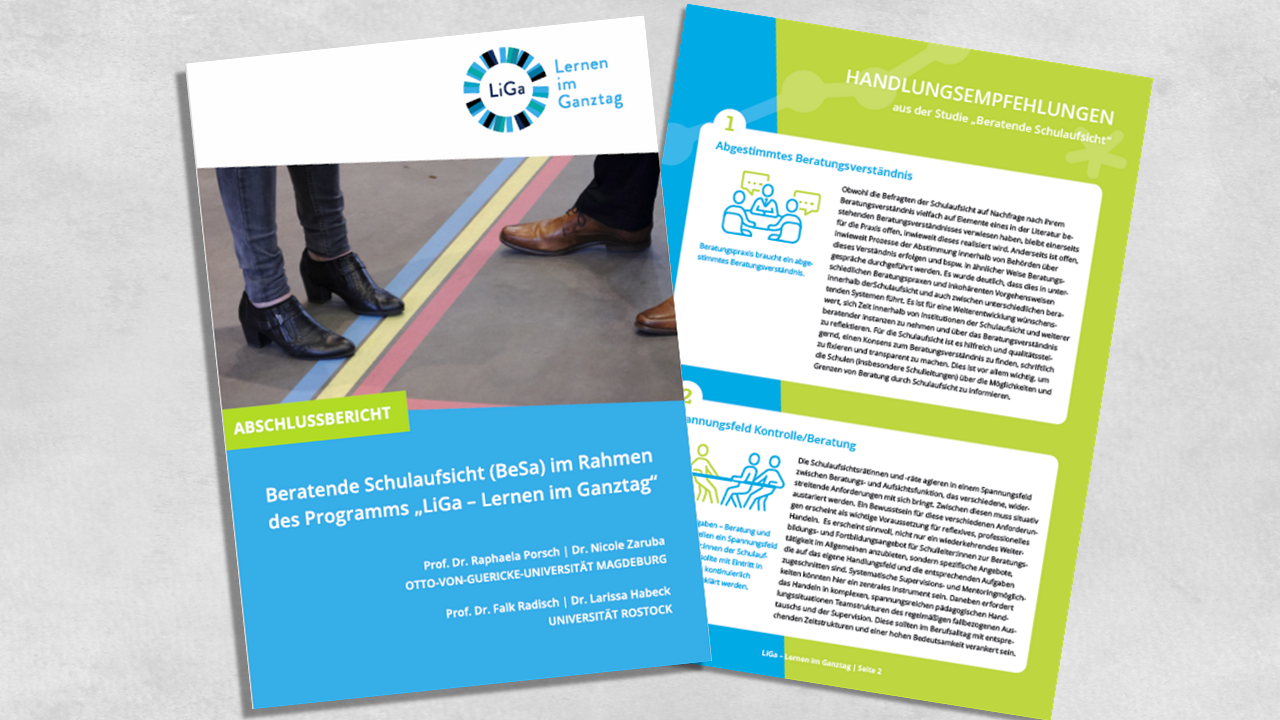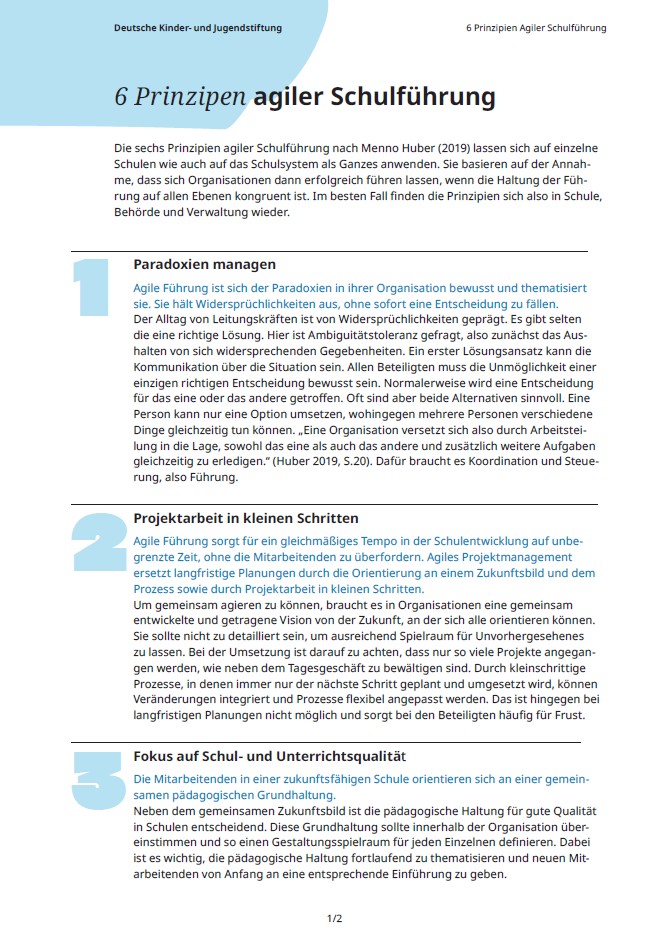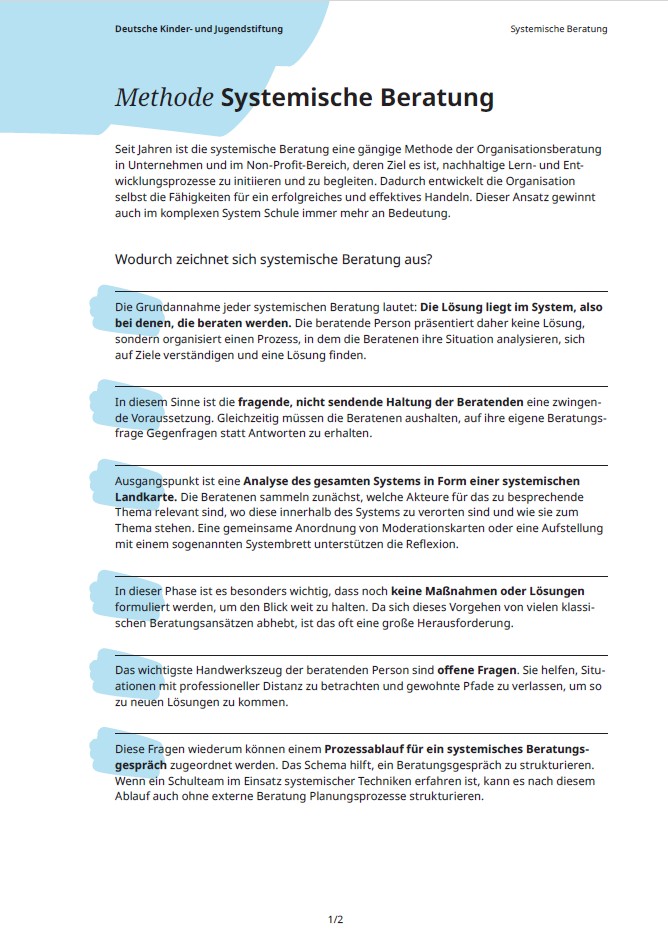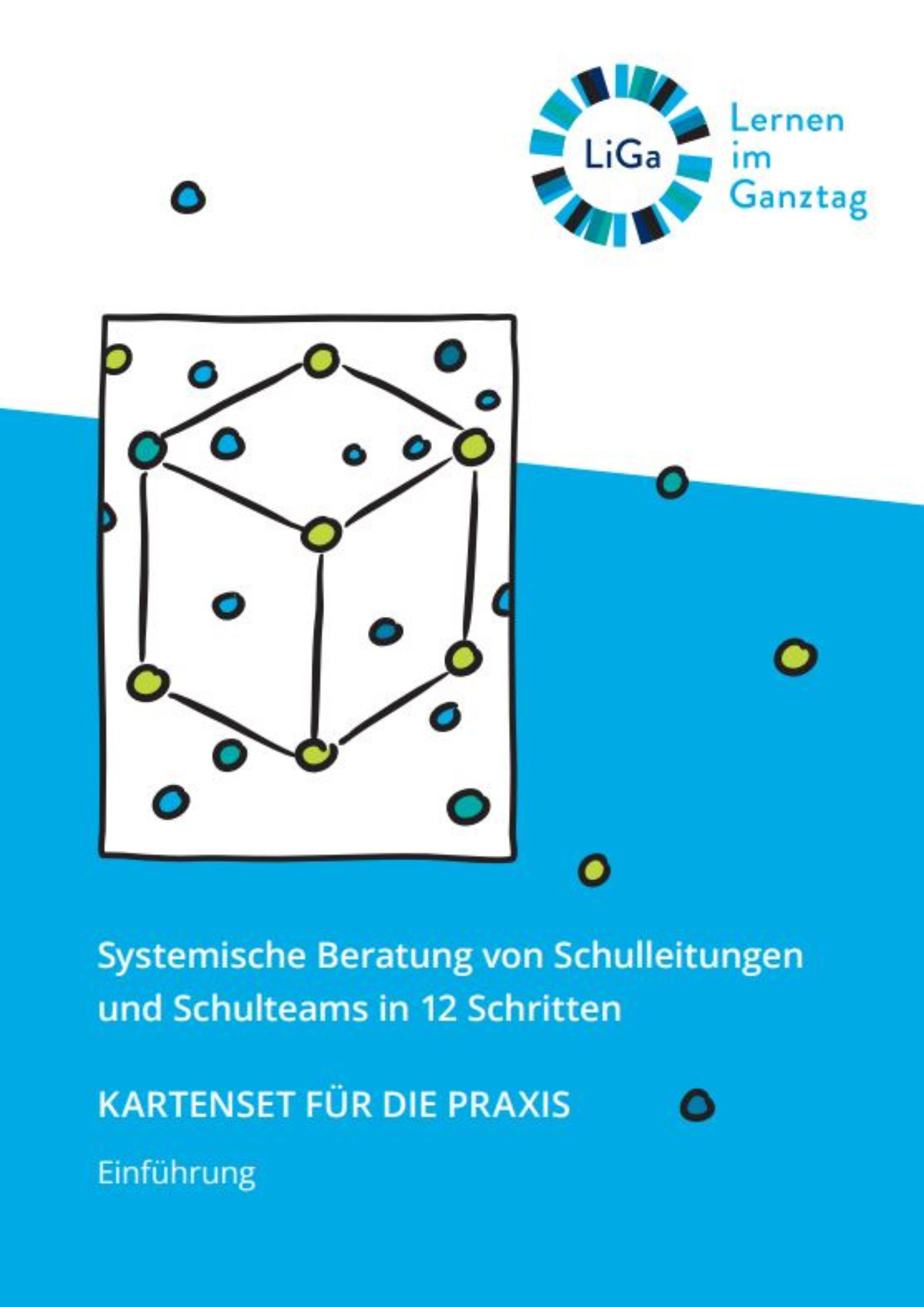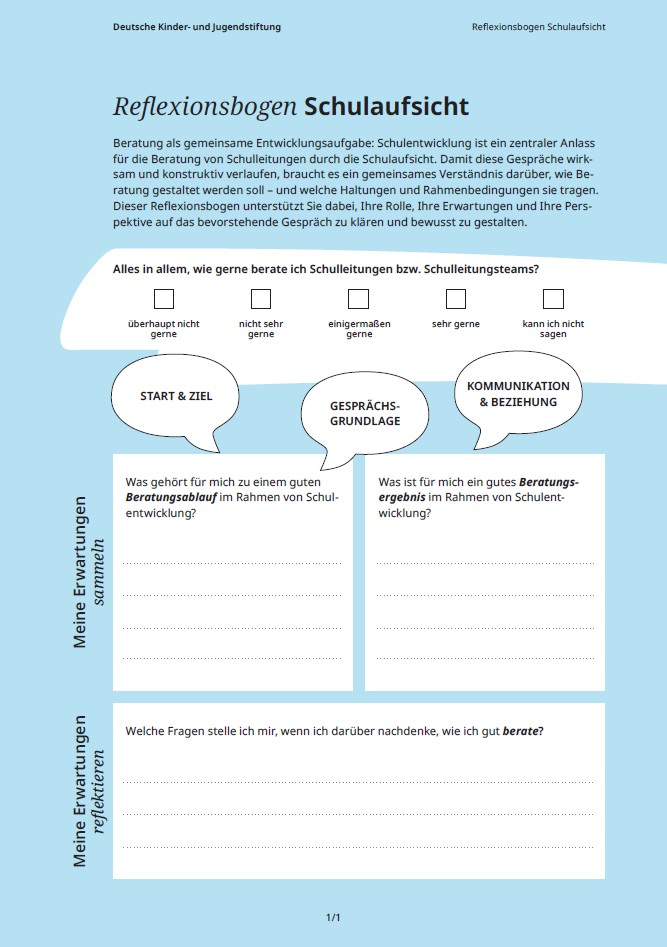Was verstehen Sie unter Kohärenz im Bildungssystem – und warum ist sie aus Ihrer Sicht so bedeutsam?
Dr. Martina Diedrich: Wir haben vielfältige institutionelle Akteur:innen, die um Schule herum dafür verantwortlich sind, Rahmenbedingungen zu schaffen sowie Schulen zu begleiten, sie zu unterstützen, aber auch zu controllen. Kohärenz bedeutet hier aus meiner Sicht, dass diese Akteur:innen im Wissen ihrer unterschiedlichen Rollen, Kompetenzen und Aufgaben, aber auch in Anerkennung dieser Unterschiede, gemeinsam und abgestimmt daran mitwirken, dass sich Schulen und das Schulsystem im Sinn gesetzter Ziele entwickeln können. Konkret geht es zunächst um die sogenannten intermediären Akteur:innen: diejenigen, die zwar mit oder für Schulen, aber nicht unmittelbar in Schule arbeiten, sprich Schulaufsichten, Ministerien, Verwaltungen, Fortbildungssysteme, Schulentwicklungsberater:innen, sonstige Unterstützungs- und Beratungseinrichtungen, die die Länder spezifisch aufgesetzt haben.
Diese Akteur:innen müssen Prozesse etablieren, in denen sie sich stärker vernetzen und miteinander abstimmen, um in ein gemeinsames Handeln und eine gemeinsame Ausrichtung zu kommen. Dazu müssen sie sowohl die jeweiligen Rollen wie auch die Schnittstellen in den Prozessen klären. Damit insbesondere Schulen das Gefühl haben: ‚Die reden nicht mit 27 Zungen, sondern die sprechen mit einer Stimme.‘ Das ist eigentlich das, worum es geht.
Warum ist unser Bildungssystem bislang eher nicht auf Kohärenz ausgerichtet worden?
Dr. Martina Diedrich: Wir haben Bildungs- und Schulsysteme, in denen die verschiedenen Rollen historisch gewachsen sind. Keines der Bildungssysteme der 16 Bundesländer ist am grünen Tisch entwickelt worden. Das heißt, keiner hat sich hingesetzt und hat gesagt, lass uns doch mal überlegen, welche Funktionen haben wir, welche Funktionen braucht es, auf welche institutionellen Köpfe verteilen wir die, wie bauen wir am besten unser System der Unterstützungs- und Beratungsstrukturen? Und wie muss das miteinander verzahnt sein und interagieren? Die Rollen und Strukturen haben sich einfach entwickelt, entsprechend hat zunächst jede:r in der eigenen Funktionslogik gedacht, und die Frage des übergreifenden Zusammenwirkens war an der Stelle häufig noch gar nicht dran. Meiner Wahrnehmung nach haben wir erst in den letzten 10 bis 15 Jahren überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass dieses System eine ganz entscheidende Gelingensbedingung dafür ist, dass Reformen greifen können. Bisher haben wir in der Schulreform entweder viel auf die Einzelschule oder auf die Strukturen geguckt. Aber wir haben wenig auf die Prozesse im die Schule umgebenden System geschaut. Erst jetzt kommt zunehmend ins Bewusstsein, dass wir hier möglicherweise ganz zentrale Stellschrauben haben, um großen Reformvorhaben zum Gelingen zu verhelfen.
Welche strukturellen oder kulturellen Herausforderungen erschweren die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteur:innen im Bildungssystem? Und was sind aus Ihrer Sicht zentrale Bedingungen oder Impulse, die solche Prozesse erfolgreich in Gang bringen können?
Dr. Martina Diedrich: Eine der Hürden ist wahrscheinlich eine zutiefst menschliche: Erstmal muss man anerkennen, dass Unterschiede und Anderssein nicht per se falsch sind. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe in der Bildungsverwaltung angefangen als Datenmensch, und da gibt es viele Zuschreibungen im Sinn von: ‚Die können keine Daten verstehen‘ oder ‚Die wollen immer alles mit Daten belegen, aber dafür haben wir überhaupt keine Kapazitäten‘.