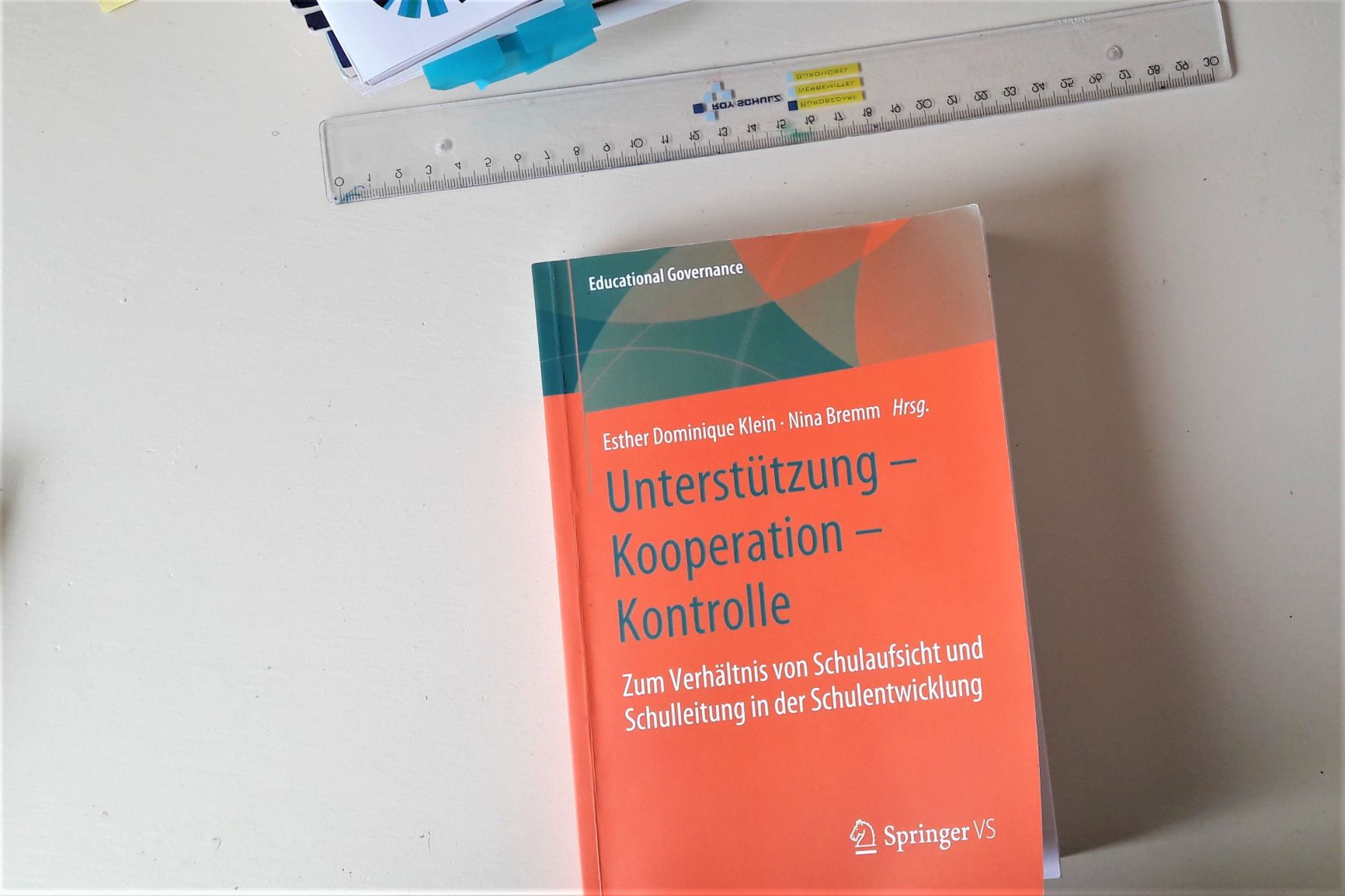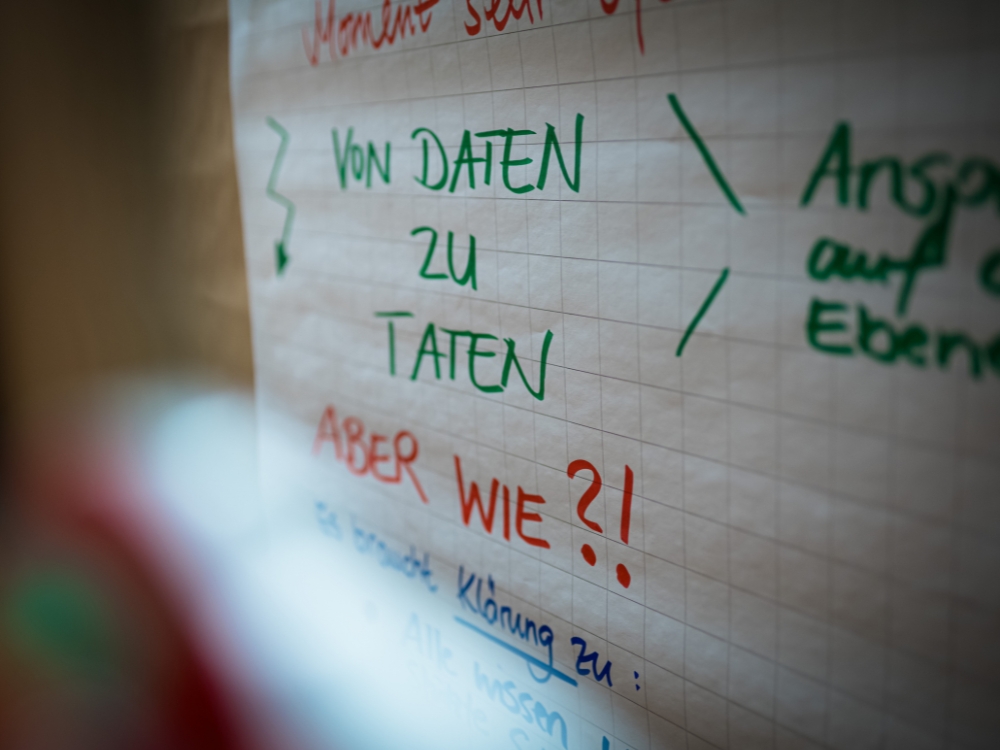Weiterhin brauchen wir klare strategische Leitlinien. Wenn wir die nicht haben, dann ist am Ende das Handeln der Schulaufsicht und der Schulen doch wieder durch die alltäglichen Aufgaben bestimmt. Wir brauchen also dringend eine klare, strategische Zielsetzung, an der sich die Schulaufsichten und mit ihnen auch die Schulen orientieren können.
Synergien schaffen durch Kooperation
Neben den zwei genannten Rahmenbedingungen braucht es die nötige personelle Aufstellung der Schulaufsicht, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können. Das ist nicht nur eine Frage der Anzahl der Beratungen, sondern auch eine Frage der Organisation: Wohin lenke ich meine Arbeitskraft und wie kann ich meine Zeit gut einsetzen, um diesem Anspruch gerecht zu werden? Da schaffen wir im Miteinander mehrerer Schulen noch viele Chancen: Wenn ich eine Schule berate, dann kann ich davon ausgehen, dass andere Schulen vielleicht ein ähnliches Problem haben. Warum dann nicht in einer Gruppe von Schulen gemeinsam daran arbeiten? Da sind also noch Synergien, die wir heben können, wenn wir Schulen in eine Kooperation miteinander bringen, sei es auf der Ebene der Führungskräfte, indem wir eine kollegiale Beratung unter den Schulleitungen organisieren oder indem man sogar in ko-konstruktive Entwicklungsprozesse geht.
Ein Beispiel dazu: Wir haben in Schleswig-Holstein begonnen, das „Leseband“ flächendeckend an Grundschulen einzuführen. Da hat es sich als sehr nützlich erwiesen, wenn gleich ganze Gruppen von Grundschulen zusammen in den Prozess starten, weil sie dann nur einmal gemeinsam den Aufwand haben, sich ihre Vorgehensweise zu überlegen. Das beschleunigt die Kommunikation mit den Schulen sowie den Prozess enorm. Dort liegt also ebenfalls ein Schlüssel jenseits von personellen Ressourcen: einfach durch eine veränderte Vorgehensweise.
Können Sie etwas zum Prozess zur Rollenentwicklung der Schulaufsicht in der KMK erzählen? Wie geht es jetzt weiter?
Alexander Kraft: Bevor die KMK die Rolle der Schulaufsicht hinterfragt hat, gab es bereits einen intensiven Arbeitsprozess zum Anforderungsprofil für Schulleiterinnen und Schulleiter von der Kommission für Lehrkräftebildung. Gleiches ist für die Schulaufsichten notwendig, weil diese als Vorgesetzte der Schulleitungen agieren und weil sie teils ähnliche Aufgaben haben, teils aber eben auch die Schulleitungen in ihrer Arbeit unterstützen. Klar wurde: Es gibt bisher kein Leitbild für Schulaufsichten bei der KMK. Tatsächlich gab es nur sehr wenige Texte zum Thema Schulaufsicht. Entsprechend war der Arbeitsauftrag, ein solches Rollenbild oder eine KMK-Empfehlung zur Rolle und Arbeit der Schulaufsicht zu entwerfen, also länderübergreifend. In diesem Arbeitsprozess haben wir zusammengestellt, was eigentlich der Kern guten schulaufsichtlichen Handelns ist.
Auf die Haltung kommt es an
Wir konnten feststellen, dass das zunächst eine Frage der Haltung ist: Wie die Schulaufsicht agiert und den Schulleitungen begegnet, bestimmt ihre Haltung und Wirkung. Ein abgestimmtes Verständnis über diese Haltung ist die Basis für die drei übergeordneten Ziele, die es zu verfolgen gilt:
- anspruchsvolle Leistungen in Schule zu ermöglichen, das heißt jedem Schüler, jeder Schülerin individuell das bestmögliche Leistungsziel zu ermöglichen,
- Chancengerechtigkeit zu erhöhen: Schule ist die Instanz, die helfen kann, unabhängig vom sozialen Hintergrund für einen chancengerechten Start in unserer Gesellschaft beizutragen. Hier sollen alle Kinder ihre Bildungsziele erreichen können und danach handlungsfähig sein, Gesellschaft mitzugestalten, sei es im Beruf oder auch im gesellschaftlichen Engagement, und
- das Wohlbefinden als Ausgangsgrundlage für gutes Lernen zu vergrößern. Das gilt für Schülerinnen und Schüler genauso wie für alle anderen, die in Schule tätig sind, denn ohne Wohlbefinden ist kein gutes Lernen möglich.
Die Haltung der Schulaufsicht muss dadurch bestimmt sein, genau diese drei Ziele in Schule zu verwirklichen und bei allem schulischen Handeln immer im Blick haben: Zahlt das auf die Ziele ein?
Neben der Haltung beschäftigt sich die KMK mit der Frage, was konkret die Aufgaben der Schulaufsicht sind. Die bisherigen gesetzlichen Regelungen beziehungsweise eine Vereinbarung der Länder zur Grundstruktur des Schulwesens besagen auf einer sehr übergeordneten Ebene, dass die Schulaufsicht die Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht über die Schulen leistet. Aber in der Rolle der Schulaufsicht steckt eben viel mehr, zum Beispiel, dass es eine pädagogische Verantwortung dafür gibt, wie die Schulentwicklung gestaltet wird, damit die übergeordneten Ziele erreicht werden können. Diese Aufgaben sollen näher ausgeführt werden, damit sich alle daran orientieren können.
Es braucht das ganze Dorf, um Schule zum Erfolg zu machen
Und drittens braucht Schulaufsicht die nötigen Kompetenzen. Über den souveränen Umgang mit Daten sprachen wir bereits. Als weitere Kernkompetenz muss die Schulaufsicht in der Lage sein, mit anderen Institutionen und mit allen Partnerinnen und Partnern von Schule tragfähige Arbeitsbeziehungen zu initiieren, aufzubauen, sie zu gestalten und dafür Sorge zu tragen, dass die Beziehungen von Vertrauen und Transparenz getragen sind, sodass alle vor Ort in der Schule gut miteinander arbeiten können. Es braucht sozusagen das ganze Dorf, um die Schule zum Erfolg zu machen. Weiterhin muss die Schulaufsicht Feedback geben, sie muss wertschätzend kommunizieren und sie muss für klare Auftragslagen sorgen können. Wenn es beispielsweise darum geht, ein „Leseband“ landesweit einzuführen, dann muss die Schulaufsicht den Schulen entsprechend kommunizieren können, was konkret der Auftrag und wie dabei der Gestaltungsspielraum der Schule ist.