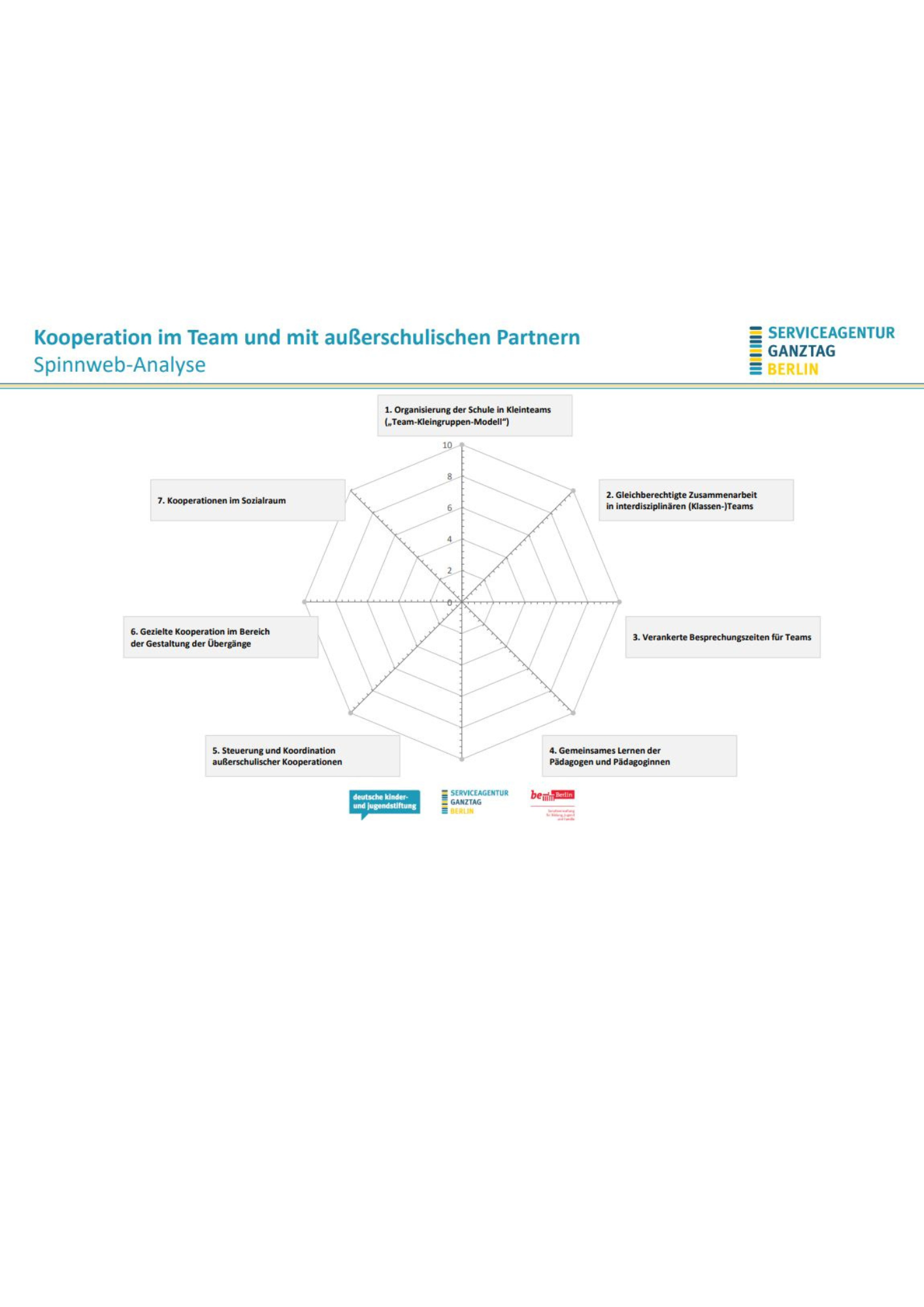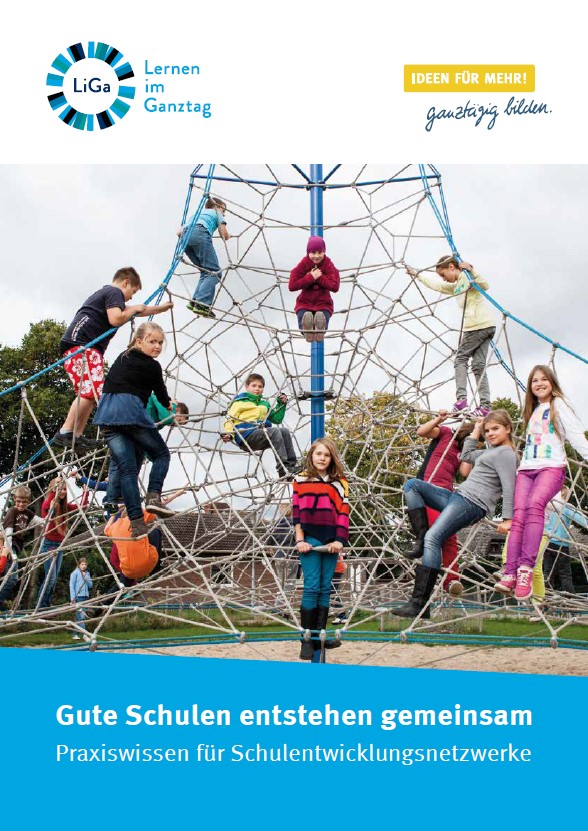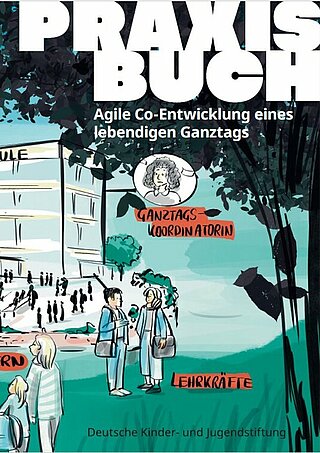Die kollegiale Fallberatung wird heute in allen Phasen der Lehrkräftequalifizierung und Beratung eingesetzt. Auch für einige Mitarbeitende der Schulaufsicht hat sie sich als nützlich erwiesen:
- als Beratungsform im kollegialen Austausch untereinander,
- als Format, das sie bei Treffen mit mehreren Schulleitungen für Austausch und Beratung auf Peer-Ebene einsetzen können,
- als methodisches Know-how, das sie an Schulleitungen vermitteln, um deren Kompetenzen zu stärken und Personalentwicklung zu fördern.
Besonderheiten und Wirkung kollegialer Fallberatung
Die Reflexionsmethode hat ihren Ursprung in der Ausbildung von Lehrkräften. Wurde sie in den Anfängen noch von psychologischem Fachpersonal angeleitet, entwickelte sich daraus später eine selbstorganisierte Beratungsform. Mit dem Bedeutungszuwachs im sozialen und pädagogischen Bereich bildeten sich eine Vielzahl von Varianten und neue Begriffsbestimmungen heraus. Dazu gehören beispielsweise Peer-Supervision, Intervision oder kollegiales Coaching. Der Verzicht auf externe professionelle Beratung hat sich in der Grundform der kollegialen Beratung jedoch als charakteristisches Merkmal durchgesetzt. Damit übernehmen alle Teilnehmenden gleichberechtigt Verantwortung im Beratungsprozess.
Als weitere Kriterien kollegialer Fallberatung beschreibt Kim-Oliver Tietze in seinem Standardwerk „Kollegiale Beratung: Problemlösungen gemeinsam entwickeln“:
- Freiwilligkeit der Teilnehmenden
- Gruppengröße von 5 bis 10 Personen, die nicht einem Team angehören müssen, aber ähnlichen beruflichen Erfahrungshintergrund mitbringen
- Ablauf folgt einer festen Struktur
- Transparenz über die Methoden der kollegialen Beratung für alle Teilnehmenden
- Verantwortung in Form von Rollen und Aufgaben wird auf alle verteilt
- gemeinsame Entwicklung von Lösungsansätzen für konkrete und aktuelle Herausforderungen in der beruflichen Praxis
Die drei Ziele: Problemlösung, Reflexion, Professionalisierung
1. Lösung von konkreten Herausforderungen im Berufsalltag
Die Gruppe sammelt Lösungsmöglichkeiten. Es wird auf den Erfahrungshintergrund und die Kompetenzen der Teilnehmenden zurückgegriffen. Im geschützten Rahmen profitiert nicht nur die bzw. der Fallgebende von der Diskussion. Das Aufzeigen alternativer Lösungsmöglichkeiten erweitert auch die multiperspektivische Sichtweise und die individuelle Problemlösefähigkeit jedes Teilnehmenden. Im Voneinander- und Miteinander- lernen entsteht eine neue Lernkultur.
2. Reflexion der beruflichen Rolle und der Berufspraxis
Der Fachaustausch ermöglicht durch einen differenzierten Blick aus der Distanz eine Erweiterung der Sichtweisen auf komplexe Zusammenhänge. Besonders die multiprofessionelle Sichtweise kann dabei eine Bereicherung darstellen. Ein weiterer Aspekt ist die berufliche Selbstkontrolle durch die Einübung einer wertschätzenden Feedback-Kultur.
3. Chance zur Professionalisierung
Kollegiale Beratung bietet die Möglichkeit, zentrale Schlüsselkompetenzen auszubauen. Dazu gehören soziale Kompetenzen, Beratungs- und Coachingkompetenzen und Methodenkompetenzen.
Ablauf der kollegialen Fallberatung
Ein kollegiales Beratungsgespräch im Team ist modular aufgebaut. Es gliedert sich in sechs Phasen, in denen die Beteiligten verschiedene Aufgaben erfüllen. Eine Beratungssitzung dauert insgesamt ca. 35 bis 45 Minuten und folgt einem transparenten zeitlichen und methodischen Ablauf.